In letzter Zeit ist in verschiedenen Diskussionen immer wieder erwähnt worden, daß Bildstabilisatoren in Makroobjektiven sinnlos oder weniger effektiv seien oder gar die Bildschärfe verschlechterten statt sie zu verbessern. Doch jede dieser Aussagen ist weder ganz richtig noch ganz falsch. Es ist ein bißchen kompliziert ... aber eigentlich doch ganz simpel, wenn man's einmal richtig verstanden hat.
Man stelle sich die Kamera mit Objektiv im Raum durchbohrt von drei virtuellen Achsen vor, eine für jede Raumdimension. Die Längsachse verläuft von der Mitte des Filmfensters bzw. des Sensors längs durchs Objektiv in Richtung zum Motiv -- diese Achse ist identisch zur sog. optischen Achse. Die Querachse schneidet die Längsachse im rechten Winkel und verläuft quer von links nach rechts. Die Hochachse schließlich schneidet ihrerseits sowohl die Längs- als auch die Querachse im rechten Winkel und verläuft demzufolge von oben nach unten. Diese drei Achsen bilden gleichsam ein dreidimensionales Koordinatenkreuz, mit x-, y- und z-Achse, und mit dem Nullpunkt (d. i. der gemeinsame Schnittpunkt aller drei Achsen) irgendwo im Inneren der Kamera. (Für Techniker und Mathematiker: Wo genau man sich diesen Nullpunkt vorstellt -- ob im Mittelpunkt des Sensors, oder bei der Eintrittspupille des Objektives, oder im Masseschwerpunkt der Kamera, oder sonstwo -- ist in diesem Zusammenhang nicht so wichtig, weil sich alle denkbaren Nullpunkte durch einfache Lineartransformationen ineinander überführen lassen.)
Nun besitzt die Kamera sechs Freiheitsgrade der Bewegungen, die sie im Raum ausführen kann, zwei für jede Raumdimension. Sie kann nämlich erstens um jede Achse rotieren, und zweitens entlang jeder Achse parallelverschoben werden. Jede tatsächliche Bewegung -- Verschiebungen und Rotationen um irgendwelche beliebigen schrägen Achsen und alle möglichen Zappeleien -- lassen sich als Linearkombination dieser sechs Basis-Bewegungen bezüglich der drei imaginären Grundachsen darstellen.
Eine perfekte (leider rein hypothetische) Bildstabilisierung würde nun die Bewegungen der Kamera in jedem dieser sechs Freiheitsgrade a) messen und b) kompensieren. Aber -- reale Bildstabilisierungsysteme tun das nicht. Stattdessen erfassen und kompensieren sie nur zwei der sechs möglichen Bewegungstypen. Nur zwei! Und genau daraus ergeben sich die Einschränkungen im Makrobereich.
Bei den zwei stabilisierten Bewegungen handelt es sich um die Rotation um die Hochachse (schwenken nach links und rechts) sowie die Rotation um die Querachse (kippen nach oben und unten). Die Rotation um die Längsachse und sämtliche Parallelverschiebungen bleiben unkorrigiert. Dies gilt übrigens sowohl für optische Bildstabilisierung (d. i. bewegliche Linsen -- z. B. bei Canon und Nikon) ebenso wie für mechanische Bildstabilisierung (d. i. beweglicher Sensor -- z. B. bei Konica-Minolta, Pentax und Sony). Der Grund für diese Beschränkung ist simpel: jene zwei Bewegungstypen sind die hauptverantwortlichen für verwackelte Bilder; die übrigen vier haben nur einen minimalen Einfluß auf die Bildschärfe. Das ist kein 80/20-Verhältnis und auch kein 90/10, sondern eher ein 99/1-Verhältnis. Soll heißen, die Schuld an einem verwackelten Bild ist zu etwa 99 % den Rotationen um Hoch- und/oder Querachse und allenfalls zu etwa einem Prozent den übrigen vier Bewegungen zuzuschreiben.
Aber (und jetzt kommt's): das gilt nur im Fernbereich. Je größer aber der Abbildungsmaßstab, desto größer der Einfluß von Parallelverschiebungen auf die Bildschärfe. Diese Zunahme ist zunächst sehr langsam -- ob Maßstab 1:1000, 1:100 oder 1:20, das macht noch keinen großen Unterschied. Aber oberhalb von etwa 1:10 nimmt dann der Einfluß der Parallelverschiebungen überproportional zu. Und weil diese von der Bildstabilisierung nicht korrigiert werden, kann es trotz Stabilisierung verwackelte Bilder geben. Natürlich wären gänzlich unstabilisierte Aufnahmen noch verwackelter ... doch in der Praxis nützt das bei sehr großen Abbildungsmaßstäben (um 1:1 herum) auch nicht mehr viel.
Dazu kommen noch zwei weitere Probleme. Erstens wird die Anforderung an die Genauigkeit, mit der die Kamera über die Entfernung zum Motiv und über die wahre Brennweite des Objektives unterrichtet sein muß, mit zunehmendem Abbildungsmaßstab immer größer. Gleichzeitig ändert sich die wahre Brennweite vieler Zoom- und Makroobjektive im Nahbereich z. T. erheblich. Dies erfordert hohe mechanische Präzision der Objektivfassung sowie ein komplexes Kommunikationsprotokoll zwischen Kamera und Objektiv. Es genügt nicht, wenn das Objektiv der Kamera einfach nur seine Nennbrennweite mitteilt. Man darf wohl davon ausgehen, daß insbesondere Fremdobjektive diesen Anforderungen nicht immer gerecht werden ... denn jeder Kamerahersteller fährt da seine eigene Schiene und wird die Interna seiner Protokolle kaum den Fremdobjektivherstellern auf die Nase binden.
Zweitens kann eine Bildstabilisierung aus simplen geometrischen Gründen stets nur die Ebene stabilisieren, auf die scharfgestellt wurde. Im Bereich vor und hinter der Einstellebene läßt die Effektivität der Stabilisierung naturgemäß nach und kann sich im Extremfall sogar ins Gegenteil verkehren. Das heißt, wenn die Stabilisierung eine Verwacklung kompensiert, dann wird die Schärfeebene unverwackelt, aber z. B. der Hintergrund weit dahinter umso stärker verwackelt abgebildet. Dieser Effekt tritt in der Praxis im Fernbereich kaum jemals auf, dafür im Nah- und Makrobereich umso öfter. Und es sieht sehr merkwürdig aus, wenn Teile des Bildes scharf und andere nicht nur unscharf, sondern auch noch partiell verwackelt sind! Unerfahrene Anwender glauben in solchen Fällen oft, das Objektiv hätte ein besonders schlimmes Bokeh ... dabei handelt es sich nur um ein Artefakt der Bildstabilisierung.
Aus diesen Gründen sollte man sich im Makrobereich nicht allzu sehr auf eine elektronische Bildstabilisierung verlassen. So phantastisch diese Errungenschaft bei großen und mittleren Aufnahmedistanzen auch funktioniert -- im Makrobereich gibt's da einige, äh, Eigentümlichkeiten. Nicht, daß es im Makrobereich gar nicht funktioniert, aber die Effizienz läßt doch stark nach. Das Stativ bleibt also weiterhin eines der wichtigsten Ausrüstungsgegenstände für Makrofotografen.
-- Olaf
Bildstabilisierung im Makrobereich
Alles was Makrofotos schöner macht oder die Arbeit erleichtert.
-
01af
- Fotograf/in
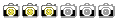
- Beiträge: 214
- Registriert: 29. Nov 2006, 17:44 alle Bilder
- Vorname: Olaf
-
Replicant
- Fotograf/in

- Beiträge: 5711
- Registriert: 2. Apr 2008, 16:55 alle Bilder
- Vorname: NonUser
Zurück zu „Tipps Makrofotografie“
Gehe zu
- Bilder-Foren
- Galerie Makrofotografie
- Portal Makrofotografie
- Naturbeobachtungen
- Naturfotografie
- Vogelfotografie
- Natur-Art
- Mikro- und Lichtschrankenfotografie
- Makrofotografie - Technische Foren
- Arbeitsgerät Makrofotografie
- Hilfsmittel Makrofotografie
- Tipps Makrofotografie
- Digitale Bildbearbeitung
- Tutorials - Makrofotografie
- Makrofotografie - interne und sonstige Foren
- Bedienungsanleitungen
- Erläuterungen u. Standpunkte der Makro-Crew
- Startseitenbeiträge
- Artenkenntnis
- Arten-Bestimmungshilfe
- Artengalerie mit Fotos und Artenportraits von Insekten und Pflanzen
- Biologische Themen - Makrofotos und ausführliche Informationen zu ausgewählten Themen aus der Natur
- Lebensräume/Biotop/Habitat
- Lebensraumtyp Moor
- Lebensraumtyp Heide und Magerrasen
- Lebensraumtyp Wald
- Lebensraumtyp Stadt und Siedlungsbereich
- Lebensraumtyp Stillgewässer
- Lebensraumtyp Fließgewässer
- Lebensraumtyp Küste
- Lebensraumtyp Acker- und Kulturland
- Lebensraumtyp Grünland
- Lebensraumtyp Stein und Fels
- Lebensraumtyp Sonderformen
- Naturschutz
- Vermehrungsstrategien in Fauna und Flora
- Brutfürsorge und Brutpflege im Tierreich
- Geburt und Tod im Tierreich
- Metamorphose und Häutung
- Sinnesorgane und Sinnesleistungen im Tierreich
- Tarnung im Tierreich
- Warnung und Verteidigung in Fauna und Flora
- Formen des Zusammenlebens in Flora und Fauna.
- Bauwerke im Tierreich
- Räuber - Beute - Beziehung in der Natur
- Ausgewählte Portraits aus Fauna und Flora
- Exoten im Tier- und Pflanzenreich
- Interessante Einzelbeobachtungen aus dem Tier- und Pflanzenreich
- Artenportraits Pflanzen - Stand: 25.08.2022
- Amaryllisgewächse - Amaryllidaceae
- Doldenblütler - Apiaceae - Stand: 23.10.2021
- Enziangewächse - Gentianaceae
- Glockenblumengewächse - Campanulaceae
- Hahnenfußgewächse - Ranunculaceae - Stand: 23.04.2021
- Korbblütler - Asteraceae
- Kreuzblütengewächse - Brassicaceae - Stand: 30.12.2021
- Liliengewächse - Liliaceae
- Lippenblütler - Lamiaceae
- Mohngewächse - Papaveraceae
- Nachtkerzengewächse - Onagraceae
- Nelkengewächse - Caryophyllaceae
- Orchideen - Orchidaceae - Stand: 12.06.2022
- Anacamptis - Hundswurzen
- Cephalanthera - Waldvöglein
- Dactylorhiza - Knabenkräuter
- Epipactis - Stendelwurzen
- Gymnadenia - Händelwurzen
- Nigritella - Kohlröschen
- Neotinea - kein deutscher Name
- Neottia - Nestwurzen
- Ophrys - Ragwurzen
- Orchis - Knabenkräuter i. e.S. - Stand: 12.06.2022
- Platanthera - Waldhyazinthen
- Spiranthes - Drehwurzen
- Hybriden
- monotypische Orchideen
- Orchideen aus dem nicht deutschsprachigen Raum
- Primelgewächse - Primulaceae
- Raublattgewächse - Boraginaceae
- Rosengewächse - Rosaceae
- Schmetterlingsblütler - Fabaceae
- Sommerwurzgewächse - Orobanchaceae
- Spargelgewächse - Asparagaceae - Stand: 15.04.2021
- Storchschnabelgewächse - Geraniaceae - Stand: 25.02.2022
- Veilchengewächse - Violaceae - Stand: 03.05.2021
- Wegerichgewächse - Plantaginaceae
- Sonstige Familien - Stand: 25.08.2022
- Artenportraits Schmetterlinge (Lepidoptera): Tagfalter im deutschsprachigen Raum - Stand: 26.08.2022
- Artenportraits Ritterfalter (Papilionidae) Stand: 16.05.2022
- Artenportraits Dickkopffalter (Hesperiidae) - Artenportraits Hesperiinae - Stand: 06.09.2021
- Artenportraits Dickkopffalter (Hesperiidae) - Artenportraits Pyrginae - Stand: 14.05.2022
- Artenportraits Weißlinge (Pieridae) - Artenportraits Weißlinge (Pierina e) - Stand: 12.06.2022
- Artenportrait Weißlinge (Pieridae) - Artenportraits Gelblinge (Coliadinae) - Stand: 02.02.2021
- Artenportraits Bläulinge (Lycaenidae) - Artenportraits "Echte Bläulinge" (Polyommatinae) - Stand: 16.05.2022
- Artenportraits Bläulinge (Lycaenidae) - Artenportraits Feuerfalter (Lycaeninae) - Stand: 08.03.2021
- Artenportraits Bläulinge (Lycaenidae) - Artenportraits Zipfelfalter (Theclinae) - Stand: 26.08.2022
- Artenportraits Edelfalter (Nymphalidae) -Artenportraits Eisvögel (Limenitidinae) - Stand: 15.05.2022
- Artenportraits Edelfalter (Nymphalidae) - Echte Edelfalter (Nymphalinae und Libytheinae) - Stand: 21.05.2022
- Artenportraits Edelfalter (Nymphalidae) - Artenportraits Perlmuttfalter (Heliconiinae) - Stand: 21.05.2022
- Artenportraits Edelfalter (Nymphalidae) - Artenportraits Schillerfalter (Apaturinae) - Stand: 09.02.2021
- Artenportraits Edelfalter (Nymphalidae) - Artenportraits Augenfalter (Satyrinae) - Stand: 09.06.2022
- Artenportraits Europäische Falter
- Artenportraits Schmetterlinge (Lepidoptera): Nachtfalter im deutschsprachigen Raum - Stand: 21.08.2022
- Eulenfalter (Noctuidae) I ohne Bärenspinner - Stand: 12.06.2022
- Eulenfalter (Noctuidae) II / Bärenspinner (Arctiidae) - Stand: 30.05.2022
- Eulenspinner (Cymatophoridae)
- Eulenspinner, Sichelflügler (Drepanidae) - Stand: 26.08.2021
- Langhornmotten (Adelidae) - Stand: 25.07.2021
- Glucken (Lasiocampidae) - Stand:21.11.2021
- Pfauenspinner (Saturniidae) - Stand: 21.05.2022
- Prozessionsspinner (Thaumepoeidae)
- Wiesenspinner (Lemoniidae)
- Schwärmer (Sphingidae) - Stand: 13.02.2022
- Spanner (Geometridae) - Stand: 12.06.2022
- Widderchen (Zygaenidae) - Stand: 31.01.2022
- Zahnspinner (Notodontidae) - Stand: 08.04.2022
- Glasflügler (Sesiidae) - Stand: 27.12.2021
- Holzbohrer (Cossidae)
- Wurzelbohrer (Hepialidae) - Stand: 29.01.2021
- Wickler, Blattroller (Tortricidae) - Stand: 02.06.2022
- Zünslerfalter(Pyralidae und Crambidae) - Stand: 21.08.2022
- Sonstige Nachtfalter - Stand: 07.05.2022
- Libellen (Odonata) - Deutsche Libellen - Artenportraits Libellen - Bestimmungshilfen Libellen - Stand: 26.08.2022
- 1. Kurzübersicht: Erklärung der bestimmungsrelevanten Merkmale bei Libellen
- 1. Kurzübersicht: Erklärung der bestimmungsrelevanten Merkmale bei Großlibellen
- 2. Großlibellen (Anisoptera)
- Edellibellen (Aeshnidae) - Stand: 26.08.2022
- Falkenlibellen (Corduliidae) - Stand: 28.11.2021
- Flussjungfern (Gomphidae) - Stand: 20.06.2021
- Quelljungfern (Cordulegasteridae)
- Segellibellen (Libellulidae) - Stand: 22.06.2022
- 3. Kleinlibellen (Zygoptera)
- Prachtlibellen (Calopterygidae) - Stand: 02.02.2021
- Teichjungfern (Lestidae) - Stand: 06.06.2022
- Federlibellen (Platycnemididae) - Stand: 24.01.2022
- Schlanklibellen (Coenagrionidae) - Stand: 10.03.2021
- 4. Verschiedene Libellen aus dem nicht deutschsprachigen Raum
- Europäische Libellen
- Afrikanische Libellen
- Amerikanische Libellen
- Asiatische Libellen
- Australische Libellen
- Libellen: Interessante Beobachtungen und Monographien - Stand: 21.05.2022
- Heuschrecken Deutschlands - Artenportraits Heuschrecken - Die Welt der Heuschrecken - Stand: 20.06.2022
- Heuschrecken - Heuschreckenarten - Heuschrecken Artenportraits
- 1. LANGFÜHLERSCHRECKEN DEUTSCHLANDS
- Sichelschrecken (Phaneropteridae) - Stand: 26.12.2020
- Eichenschrecken (Meconematidae)
- Schwertschrecken (Conocephalidae)
- Singschrecken - Unterfamilie Beißschrecken (Decticinae) - Stand: 04.01.2022
- Singschrecken - Unterfamilie Heupferde (Tettigoniinae)
- Sattelschrecken (Bradyporidae) - Stand: 18.12.2019
- Buckelschrecken (Rhaphidophoridae)
- Maulwurfsgrillen (Gryllotalpidae)
- Ameisengrillen (Myrmecophilidae)
- Echte Grillen (Gryllidae) - Stand: 28.04.2022
- 2. KURZFÜHLERSCHRECKEN DEUTSCHLANDS
- Dornschrecken (Tetrigidae) - Stand: 06.06.2022
- Feldheuschrecken - Unterfamilie Schönschrecken (Calliptaminae) - Stand: 11.08.2021
- Feldheuschrecken- Unterfamilie Knarrschrecken (Catantopinae)
- Feldheuschrecken - Unterfamilie Ödlandschrecken (Oedipodinae) - Stand: 20.06.2022
- Feldheuschrecken - Unterfamilie Grashüpfer (Gomphocerinae) - Stand: 09.01.2022
- HEUSCHRECKEN ÖSTERREICHS
- HEUSCHRECKEN der SCHWEIZ - Stand: 02.03.2022
- HEUSCHRECKEN EUROPAS - Stand: 07.11.2021
- Hautflügler (Hymenoptera) Deutschlands - Artenportraits Hautflügler, z.B. Bienen, Wespen- Stand: 19.12.2022
- Hautflügler Hymenoptera - Artenportraits und Bildersammlungen
- 1. Taillenwespen (Apocrita) -Artenportraits und Bildersammlungen
- Echte Bienen (Apidae) - Artenportraits - Stand: 14.02.2022
- Kropfsammler (Colletidae) - Seidenbienen, Maskenbienen - Artenportraits und Bildersammlungen - Stand: 19.08.2021
- Bauchsammler (Megachilidae)- Blattschneider-, Mauer-, Woll-, Harzbienen- Artenportraits-Stand: 14.03.2022
- Sandbienen (Andrenidae) - Sandbienen - Artenportraits und Bildersammlungen - Stand: 17.05.2021
- Furchenbienen (Halictidae) - Furchenbienen, Schmalbienen - Artenportraits und Bildersammlungen - Stand: 02.03.2022
- Melittidae (kein dt. Name) - Hosen-, Schenkelbienen - Artenportraits - Stand: 18.02.2021
- Grabwespen (Spheciformes) - Sphecidae und Crabonidae - Artenportraits und Bildersammlungen - Stand: 19.01.2022
- Faltenwespen (Vespidae) - Artenportraits und Bildersammlungen - Stand: 17.04.2022
- Dolchwespen (Scoliidae) - Artenportraits und Bildersammlungen
- Ameisen (Formicidae) - Artenportraits und Bildersammlungen - Stand: 19.12.2022
- Goldwespen (Chrysididae) - Artenportraits und Bildersammlungen
- Schlupfwespen und Brackwespen (Ichneumonidae, Braconidae) - Artenportraits und Bildersammlungen - Stand: 12.09.2021
- Überfamilie Evanioidea - Artenportraits und Bildersammlungen - Stand: 15.12.2022
- Erzwespen (Überfamilie Chalcidoidea) - Artenportraits und Bildersammlungen - Stand: 12.02.2022
- Gallwespen (Cynipidae) - Artenportraits und Bildersammlungen - Stand: 10.02.2021
- Wegwespen (Pompilidae) - Artenportraits und Bildersammlungen
- 2. Pflanzenwespen (Symphyta) - Artenportraits und Bildersammlungen
- Bürstenhornblattwespen (Argidae) - Artenportraits und Bildersammlungen
- Echte Blattwespen (Tenthredinidae) - Artenportraits und Bildersammlungen - Stand: 17.04.2022
- Keulhornblattwespen (Cimbicidae) - Artenportraits und Bildersammlungen - Stand: 01.05.2022
- Holzwespen (Siricidae) - Artenportraits und Bildersammlungen
- Sonstige Pflanzenwespen - Artenportraits und Bildersammlungen
- 3. Kronenwespen (Stephanidae) - Stand: 22.02.2021
- Hautflügler: Interessante Beobachtungen und Monografien
- Zweiflügler (Diptera) - Artenportraits Zweiflügler, z. B. Schweb-, Raubfliegen, Bremsen etc. - Stand: 26.08.2022
- Forum für Bestimmungshilfen
- Schwebfliegen (Syrphidae) - Syrphinae - Stand: 30.05.2022
- Schwebfliegen (Syrphidae) - Microdontinae und sonstige Unterfamilien
- Schwebfliegen (Syrphidae) - Eristalinae - Stand: 07.11.2021
- Wollschweber (Bombyliidae) - Stand: 04.12.2021
- Dickkopffliegen/Blasenkopffliegen - (Conopidae) - Stand: 27.11.2021
- Raubfliegen (Asilidae) - Asilinae - Stand: 06.06.2022
- Raubfliegen (Asilidae) - Brachyrhopalinae
- Raubfliegen (Asilidae) - Dasypogoniae
- Raubfliegen (Asilidae) - Dioctriinae - Stand: 21.01.2022
- Raubfliegen (Asilidae) - Laphriinae - Stand: 10.12.2021
- Raubfliegen (Asilidae) - sonstige Raubfliegen-Arten
- Sonstige Fliegen - Stand: 22.08.2022
- Unterordnung Mückenartige (Nematocera) - Stand: 11.03.2022
- WANTED
- Käfer (Coleoptera) Deutschlands - Artenportraits Käfer - Stand: 20.06.2022
- Aaskäfer (Silphidae) - Stand: 28.04.2022
- Blatthornkäfer (Scarabaeidae) - Stand: 09.06.2022
- Blattkäfer (Chrysomelidae) - Stand 23.05.2022
- Bockkäfer (Cerambycidae) - Stand: 16.05.2022
- Buntkäfer (Cleridae) - Stand: 06.01.2022
- Düsterkäfer (Serropalpidae) Stand: 18.07.2017
- Feuerkäfer (Pyrochroidae) Stand: 28.08.2017
- Kurzflügler (Staphylinidae) - Stand: 21.01.2022
- Laufkäfer (Carabidae) - Stand: 22.05.2022
- Marienkäfer (Coccinellidae) - Stand: 15.07.2021
- Mistkäfer (Geotrupidae) - Stand: 18.07.2017
- Ölkäfer (Meloidae) Stand: 03.04.2021
- Prachtkäfer (Buprestidae) - Stand: 07.06.2021
- Rüsselkäfer (Curculionidae) -Stand: 05.06.2022
- Weitere Rüsselkäferartige (Curculionoidea) - Stand: 23.05.2022
- Scheinbockkäfer (Oedemeridae) - Stand: 18.07.2017
- Schnellkäfer (Elateridae) - Stand: 01.06.2022
- Schröter (Lucanidae) - Stand: 24.01.2022
- Schwarzkäfer (Tenebrionidae) Stand: 21.01.2022
- Stutzkäfer (Histeridae) - Stand: 18.07.2017
- Weichkäfer (Cantharidae) - Stand: 18.07.2017
- Zipfelkäfer (Malachiidae) Stand: 01.05.2022
- Sonstige Käfer - Stand: 20.06.2022
- Wanzen (Heteroptera) Deutschlands - Artenportraits Wanzen - Stand: 24.08.2022
- 1. Wanzen - Heteroptera: Anatomie, Kurzbeschreibung der Wanzen Deutschlands
- 2. Baumwanzen i.w.S. (Pentatomorpha)
- Baumwanzen (Pentatomidae) - Stand: 05.02.2022
- Stachelwanzen (Acanthosomatidae) - Stand: 29.11.1021
- Schildwanzen (Scutelleridae)
- Erdwanzen (Cydnidae) - Stand: 28.04.2020
- Stelzenwanzen (Berytidae)
- Boden-oder Langwanzen (Lygaeidae) - Stand: 14.02.2022
- Feuerwanzen (Pyrrhocoridae)
- Randwanzen oder Lederwanzen (Coreidae) - Stand: 19.01.2022
- Krummfühlerwanzen (Alydidae)
- Glasflügelwanzen (Rhopalidae)
- Stenocephalidae
- 3. Cimicomorpha
- Weichwanzen / Blindwanzen (Miridae) - Stand: 24.08.2022
- Raubwanzen (Reduviidae) - Stand: 19.02.2020
- Sichelwanzen (Nabidae) - Stand: 14.02.2022
- Blumenwanzen (Anthocoridae)
- Gitterwanzen (Tingidae)
- 4. Sonstige Wanzen - Stand: 24.06.2021
- Zikaden (Auchenorrhyncha) Deutschlands - Artenportraits Zikaden - Stand: 05.06.2022
- WANTED
- Sonstige Insekten - Artenportraits Fangschrecken, Schmetterlingshafte, Kugelspringer etc. - Stand: 09.06.2022
- Eintagsfliegen (Ephemeroptera) - Stand: 12.02.2021
- Fangschrecken (Mantodea) - Stand: 13.10.2021
- Schaben (Blattodea)
- Ohrwürmer (Dermaptera)
- Gespenst- und Stabschrecken (Phasmida)
- Schnabelhafte (Mecoptera)
- Netzflüglerartige - Großflügler (Megaloptera) - Schlammfliegen (Sialidae) - Stand: 18.04.2022
- Netzflüglerartige - Kamelhalsfliegen (Raphidioptera) - Stand: 07.05.2022
- Netzflüglerartige - Netzflügler (Neuroptera) - Schmetterlingshafte (Ascalaphidae)
- Netzflüglerartige - Netzflügler (Neuroptera) - Ameisenjungfern (Myrmeleontidae) - Stand: 11.03.2022
- Netzflüglerartige - Netzflügler (Neuroptera) - Bachhafte (Osmylidae)
- Netzflüglerartige - Netzflügler (Neuroptera) - Fadenhafte (Nemopteridae)
- Netzflüglerartige - Netzflügler (Neuroptera) - Fanghafte (Mantispidae) - Stand: 15.12.2021
- Netzflüglerartige - Netzflügler (Neuroptera) - Florfliegen (Chrysopidae) - Stand: 17.02.2021
- Netzflüglerartige - Netzflügler (Neuroptera) - Taghafte (Hemerobiidae) - Stand: 28.05.2021
- Fischchen (Zygentoma)
- Felsenspringer (Archaeognatha)
- Springschwänze (Collembola) - Stand:09.03.2021
- Steinfliegen (Plecopeta) - Stand: 09.06.2022
- Köcherfliegen (Trichoptera) Stand: 28.03.2022
- Spinnentiere (Arachnida) Deutschlands - Artenportraits Webspinnen und Spinnentiere - Stand: 20.06.2022
- 1. Webspinnen (Araneae) - Stand: 24.09.2021
- Dornfingerspinnen (Miturgidae)
- Fischernetzspinnen (Segestriidae)
- Finsterspinnen (Amaurobiidae)
- Krabbenspinnen (Thomisidae) - Stand: 02.05.2022
- Kräuselradnetzspinnen (Uloboridae)
- Kugel- oder Haubennetzspinnen (Theridiidae) - Stand: 04.03.2021
- Laufspinnen (Philodromidae) - Stand: 06.06.2022
- Luchsspinnen (Oxyopidae)
- Plattbauchspinnen (Gnaphosidae)
- Radnetzspinnen (Araneidae) - Stand: 20.06.2022
- Jagdspinnen - Raubspinnen (Pisauridae) - Stand: 11.03.2022
- Riesenkrabbenspinnen (Sparassidae) - Stand: 06.06.2022
- Röhrenspinnen (Eresidae) - Stand: 20.02.2022
- Sackspinnen (Clubionidae)
- Sechsaugenspinnen (Dysderidae)
- Speispinnen (Scytodidae)
- Springspinnen (Salticidae) - Stand: 01.06.2022
- Streckerspinnen (Tetragnathidae)
- Tapezierspinnen (Atypidae) - Stand: 09.12.2021
- Trichterspinnen (Agelenidae) - Stand: 10.02.2022
- Wolfspinnen (Lycosidae) - Stand: 01.06.2022
- Zitterspinnen (Pholcidae)
- Andere Familien Stand: 11.03.2022
- 2. Spinnentiere (ex. Araneae)
- Milben und Zecken (Acari) - Stand: 27.01.2021
- Weberknechte (Opiliones) - Stand: 27.02.2021
- WANTED
- Spinnentiere: Interessante Beobachtungen und Monografien - Stand: 01/21
- Amphibien Deutschlands - Artenportraits Amphibien (Amphibia) - Stand: 21.05.2022
- Weitere Amphibien Europas
- Amphibien: Interessante Beobachtungen oder Einzelmonografien - Stand: 21.05.2022
- Reptilien Deutschlands - Artenportraits Reptilien - Echsen, Schlangen, Schildkröten - Stand: 20.06.2022
- Weitere Reptilien Europas
- Echte Eidechsen Europas - Stand: 04.12.2021
- Reptilien: Interessante Einzelbeobachtungen oder Einzelmonographien aus dem Leben der Reptilien
- Wirbellose Tiere (Invertebrata) in der Makrofotografie ohne Insekten und Spinnentiere - Artenportraits - Stand: 09.06.2022
